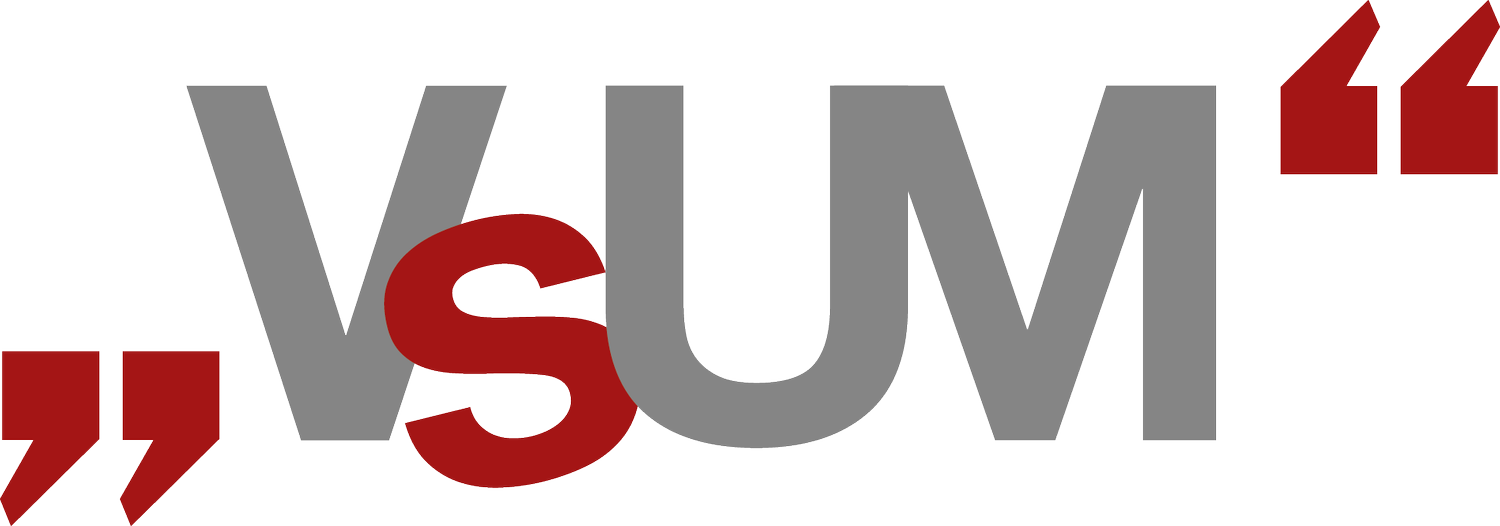Der ORF ist eine Säule unserer Demokratie
Der ORF ist eine Säule unserer Demokratie
Blogeintrag von Golli Marboe, 01. Juni 2020
Wenn wir das öffentlich rechtliche Rundfunksystem in Frage stellen, dann nähern wir uns autokratischen Systemen.
Natürlich muss auch eine Institution, wie der ORF weiter entwickelt, verbessert und reformiert werden – aber im Sinne unserer Meinungsvielfalt und nicht im Sinne von Macht- oder Marktinteressen.
Ganz besonders gilt das in Kenntnis der österreichischen Medienlandschaft! Zugegeben – ich bin durch den ORF geprägt:
Als Kind von Clown Enrico, als Jugendlicher von den Kunststücken, als Älterer von Hugo Portisch und inzwischen von einer beinahe 24 stündigen Radiobegleitung durch Ö1.
Der ORF verkörpert für mich ein Stück Familie und wohl auch meine österreichische Identität. Eine Identität, die sich durch Weltoffenheit und den Blick über den Tellerrand formuliert:
Wenn man an die Berichte der Auslandskorrespondenten in den Informationsformaten, an Filmprojekte von Michael Haneke, Julian Pölsler oder Andreas Prohaska denkt, wenn das Haus ORF weibliche Kreative, wie Sabine Derflinger „featured“, oder wenn kritischen Geistern dieses Landes, wie David Schalko oder Florian Scheuba Raum für ihre Arbeiten ermöglicht wird.
Aber neben diesem „name-dropping“ von Kreativen wird die Kraft und die Bedeutung eines öffentlich rechtlichen Rundfunks für ein Land, wie Österreich doch besonders deutlich, wenn man sich unser Land ohne ORF vorstellt:
Wo wäre der Gegenpol zu den Medienhäusern der Familien Dichand, Mateschitz und Fellner?
Was wäre die Alternative zu werbefinanzierten elektronischen Medien ala ATV?
In den Visegrad-Staaten oder am Westbalkan lässt sich außerdem gut beobachten, was es bedeutet, wenn Medien – die sich im Staatsbesitz befinden – zu besseren PR Stellen der jeweils Regierenden umgebaut werden.
So wie ja auch wir das im deutschsprachigen Raum vor dem Jahr 1945 kannten und erleiden mussten. Erst mit dem ORF, einem Medienunternehmen strukturiert nach dem Vorbild der BBC, wurde eine Kultur der Berichterstattung etabliert, bei der die Journalisten im Auftrag der Bürger die Mächtigen und die Regierenden kontrollieren und eben nicht deren Taten bewerben und verkündigen.
Die vor Kurzem in der Schweiz zu den Gebühren abgehaltene Volksabstimmung hat im sehr beeindruckenden und mit Argumenten geführten Diskurs deutlich gemacht, dass ein Land in der Größe der Schweiz, ohne staatliche Unterstützung keinen eigenständigen originären Programmstock mehr herstellen könnte.
Eine „mediale Kolonialisierung“ durch kommerzielle Sendergruppen (insbesondere aus Deutschland mit der RTL und der ProSiebenSat.1 Gruppe (auch die Besitzer vonPuls4 / ATV) standen im Raum.
Und schließlich: die Kommunikationsfreiheit durch das Netz hat zu keiner Verbesserung der Qualität von Informationen geführt. Im Gegenteil: Gerüchte, Sachverhaltsdarstellungen und Halbwahrheiten stehen auf vielen Plattformen durchaus gleichberechtigt nebeneinander.
Die „Unterscheidung der Geister“, das Sortieren von Informationen wird durch die Fülle der nun möglichen Informationsquellen wichtiger denn je.
Die umstrittene Aufgabe des „Gate-Keepers“- also die Funktion einer Journalistin, die die ihr vorliegenden Informationen ergebnisoffen recherchiert und dann daraus die vermeintlich wesentlichsten Aspekte für den Rezipienten zusammenfasst – bekommt durch die Digitalisierung eine Relevanz, wie wohl noch nie zuvor in unserer Mediengeschichte.
Und wem wollte man mehr vertrauen, als Journalisten von öffentlich rechtlichen Rundfunkanstalten?
Warum gibt es öffentlich rechtliche Medien nur in westeuropäischen Demokratien?!
Weder in totalitären, noch in kapitalistisch orientierten Systemen ist Raum für diese vierte kontrollierende Gewalt im Staat. Gerade einmal wir in Westeuropa haben bisher den Schritt zu dieser zusätzlichen Instanz für Bildung und Demokratie geschafft. Warum also öffentlich rechtlich?
Weil eine Gesellschaft eine Kraft im Lande braucht, die ergebnisoffen Fragen stellt, ohne auch Urteile fällen zu müssen!
Weil es eine Einrichtung braucht, die als Alternative zur aufgeregten Berichterstattung im Netz, im Sinne einer Äquidistanz die Chronik der Ereignisse archiviert.
Weil wir Journalisten mit Redakteursstatut als Gewissen im Land brauchen. Journalisten, die keiner Blattlinie des Herausgebers zu folgen haben, oder darauf achten müssen, dass mit ihren Artikeln möglichst viele Klicks für die Werbekunden erzielt werden.
Dazu zehn Gedanken, wie der ORF sich in diesem Sinne als öffentlich rechtliche Instanz – für die kommenden Jahren aufstellen könnte:
1. das Programm muss wieder im Zentrum der Diskussionen zum ORF stehen
Der ORF ist mehr als seine Nachrichtensendungen und mehr als der Vergleich, wie lange welche Politiker darin vorkommen. Außerdem sollte weniger über Posten und mehr über die Qualität des Angebots diskutiert werden.
2. mittelfristig soll der ORF werbefrei finanziert werden
Niemand kann der Diener zweier Herren sein.
Natürlich soll es keine Abhängigkeit von der Politik geben, aber auch keine von Werbekunden oder von Privateigentümern 3. ein relevantes, werbe und gewaltfreies Angebot für Kinder muss geschaffen werden.
Die BBC setzt ca. 6% ihrer Mittel für Kinderprogramme ein, der ORF wohl nicht einmal 0,6%. Insbesondere im Sinne von Bildung und Demokratie ist es originäre Aufgabe eines öffentlich rechtlichen Senders anspruchsvollen Content für Kinder und damit auch Sicherheit für deren Eltern zu bieten.
4. ORF Sport + soll zu einem Sportsender werden, der auch populäre Ereignisse senden darf
Schon damit die anderen ORF Sender, wie ORF eins und ORF zwei deren Programmschema nicht immer wieder durch Sport-Liveübertragungen unterbrechen müssen, sollte ein nächstes ORF Gesetz in Zukunft auch Fußballspiele oder Schirennen auf ORF Sport plus erlauben.
5. der ORF wäre prädestiniert als Vorreiter für den mitteleuropäischen Raum zu agieren
Das Selbstverständnis eines österreichischen Senders von heute sollte auch ein europäisches sein. zb durch eine entsprechende ORF eins Reform könnte ein Sender entstehen, der sich als Programm für Mittel- und Zentraleuropa versteht.
6. Ein Archiv, das für alle Staatsbürger zugänglich ist
Programme, die vom Gebührenzahler finanziert wurden, sollten für die Staatsbürger auch länger als sieben Tage zugänglich sein.
7. die Darstellung unseres Alltags durch tägliche Dokumentationen
Hergestellt von einer eigenen Redaktion für investigativen Journalismus a la „Monitor“, oder auch einer eigene Unit für „constructive journalism“; jedenfalls mit einem Sendeplatz für „Human interest“ a la „37 Grad“ oder „Menschen Hautnah“.
8. viel mehr Journalismus in der Unterhaltung und damit mehr Qualität
Weniger Einwegprodukte, mehr Werthaltigkeit.
9. die Rolle der Landesstudios neu definieren
Neben der regionalen Berichterstattung sollte jedes Landesstudio auch mit einem überregionalen Bereich betraut werden. Nicht zuletzt, um damit dem so augenscheinlichen gesellschaftlichen Gefälle zwischen Stadt und Land zu begegnen.
Warum arbeitet ORF Sport+ nicht von Innsbruck aus, oder ein neuer auf Mitteleuropa ausgerichtetes ORF eins nicht von Graz, ein noch zu schaffender Kinderkanal aus Linz oder ORF III tatsächlich von Salzburg aus.
10. Jeder österreichische Schüler soll zumindest einmal im Leben ein Projekt mit dem ORF herstellen
Es geht um eine intensivere Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen.
Damit könnte der ORF seinen Beitrag im Sinne Prof. Bernhard Pörksens (Universität Tübingen) leisten: „Wir stehen an der Schwelle von der Digitalen zu einer„redaktionellen Gesellschaft“ und dafür müssen die Menschen nach Lesen, Schreiben und Rechnen eine vierte Kulturtechnik erwerben: „den Umgang mit Medien“!“