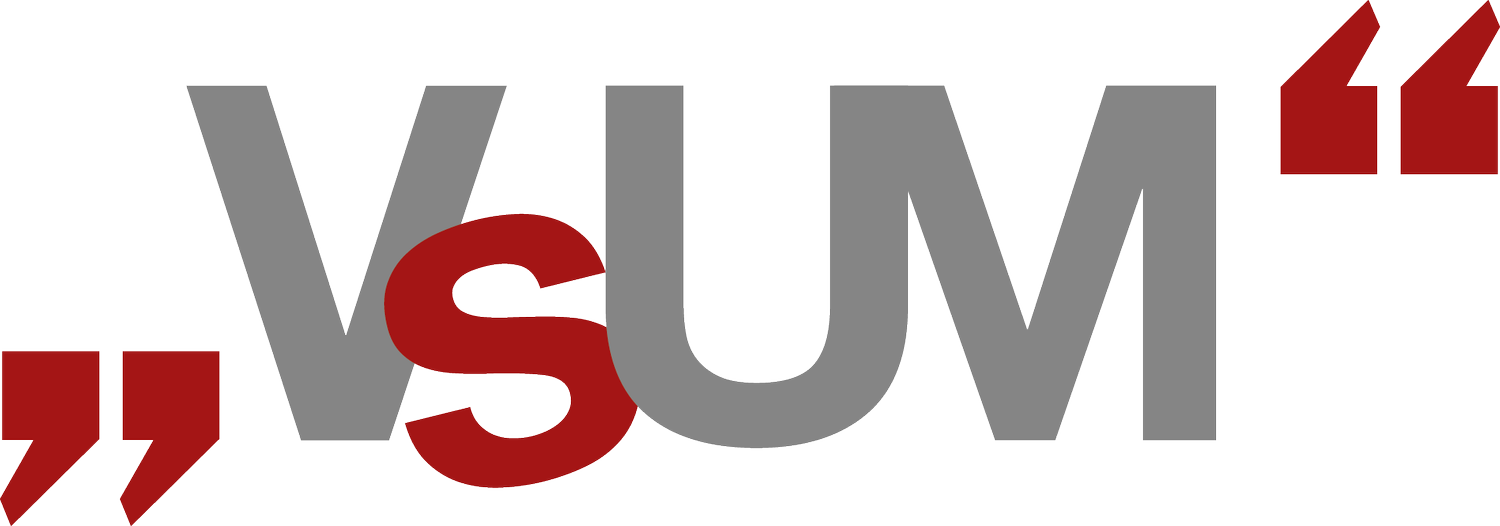Open Source
Open Source
Dossier Österreich | Interview
ORF-Publikumsratsmitglied Golli Marboe über die vielen Dinge, die in Österreichs größter Medienorgel anders klingen sollten, wenn sie auch morgen noch wahrgenommen werden will.
Golli Marboe im Gespräch mit Roman Scheiber, Erstveröffentlichung: ray Filmmagazin im September 2020Er war Film- und Fernsehproduzent („Sternstunden“), verantwortete hunderte Stunden TV-Sendezeit und versuchte sich im Fach europäischer Ko-Produktionen. Sein Hauptkunde war arte gewesen, bevor er sein Unternehmen schließlich quantitativ überforderte und in Konkurs gehen musste. Damit geht er ebenso offen um wie mit dem bislang größten Verlust in seinem Leben: Seit einer seiner Söhne sich das Leben genommen hat, setzt Golli Marboe sich für einen angemessenen und ehrlichen Umgang mit dem häufig tabuisierten Thema in den Medien ein. Sein Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien (VsUM) bietet zum Beispiel am 14. Oktober eine hochkarätige Diskussionsveranstaltung zur Berichterstattung über Suizide an.
Marboe wurde im Zuge eines Hearings von den NEOS für einen Sitz im ORF-Publikumsrat ausgewählt. In dieser Funktion setzt er sich u.a. für eine Gremienreform ein: statt zwei Gremien nur eines, in dem die Zivilgesellschaft wie etwa beim ZDF die Mehrheit haben sollte. Vor allem aber möchte Golli Marboe den ORF inhaltlich und geschäftlich reformiert sehen: mehr Aufträge für die heimische Kreativwirtschaft statt teurer Lizenzen, mehr Probieren statt Quoten studieren, journalistische Modernisierung und digitales Storytelling statt Technokraten an der Macht. Über alle seine vielen Reformideen zu sprechen, hätte den Rahmen gesprengt. Das folgende Gespräch, das in seinem Projektbüro neben dem Publizistikinstitut der Uni Wien stattfand, konzentriert sich daher auf programmliche und strukturelle Vorschläge.
Herr Marboe, Sie sind ORF-Publikumsrat. Der ORF steht vor großen Herausforderungen, bald steht die Wahl des Generaldirektors an, zudem hat er wie alle Medien mit den Folgen der Corona-Krise zu kämpfen und stand schon davor unter Druck der privaten Konkurrenz. Wie damit umgehen?
Golli Marboe: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist dazu da, Dinge zu artikulieren, die sich in unserer Gesellschaft wiederfinden. Und Demokratie formuliert sich bei Gott nicht nur über den Mehrheitsgeschmack, sondern über die angstfreie Artikulations-chance eines oder einer Einzelnen und über die Innovationskraft der Einzelnen, die das auch ausdrücken können. Und wo sollte man Ideen, Projekte und in unserem konkreten Fall eben Filme, Drehbücher oder Serien artikulieren können, wenn nicht im Öffentlich-Rechtlichen? Vor allem, wenn sie ein bisschen ungewöhnlich sind und noch nicht fixen Routinen folgen. Das hat ja die Privatwirtschaft nicht – diese Chance, über die Finanzierung der Allgemeinheit etwas auszuprobieren. Dementsprechend wäre ich ein großer Freund davon, dass der ORF viel proaktiver nach neuen Wegen sucht, wie man Geschichten erzählen kann. Dass er eine Plattform bietet für Kunst und Kultur, für Medien- und Filmschaffende, die etwas zeigen möchten, was es noch nicht gibt und was die Allgemeinheit in ein paar Jahren vielleicht mögen wird. Ich glaube, dass dies in einigen Bereichen sehr gut funktionieren kann.
Zum Beispiel?
G. M.: Schauen Sie sich in Deutschland funk.net an. Eine „online only“-Plattform, finanziert aus Mitteln von ARD und ZDF. Dort gelingt es, Innovation und Information in einer Form zu präsentieren, die offenbar zu unserer Zeit passt. Oder sehen Sie sich die Comedy-Szene an! Da gibt es Jan Böhmermann, die „heute-show“, „extra 3“, „Die Anstalt“. Auch junge Menschen, die alles nur mehr digital schauen, mögen diese satirischen öffentlich-rechtlichen Innovationen. Weil dort die politische Freiheit da ist, weil du dich über Werbekunden lustig machen kannst, weil du im Öffentlich-Rechtlichen Phänomene angreifen kannst, die vielleicht von den Privaten nicht angegriffen werden könnten. Weil die Privaten davon leben, dass sie gegen viel Geld Clips geschaltet bekommen und der ORF diese Clips gratis ausstrahlt.
Im ORF gibt es „Willkommen Österreich“ oder „Gute Nacht, Österreich“ …
G. M.: „Willkommen Österreich“ gehört zu den in der TVthek meist abgerufenen Formaten des ORF. Ja, wir bräuchten viel mehr Formate dieser Art!
Wären Sie Generaldirektor, was wären Ihre Grundideen für den ORF?
G. M.: Erstens: die Innovationskraft stärken. Zweitens das Medium selbst als Experimentierplattform etablieren, nicht im abgehobenen Orchideenverständnis, sondern im Verständnis einer Serienoffensive, wie sie etwa auf HBO, Netflix oder anderen Pay-Anbietern transportiert wurde. Weil Öffentlich-rechtlich und Pay-Anbieter in einem Sinn sehr verwandt sind, dort wird nämlich für etwas Besonderes bezahlt. Und ich als Staatsbürger möchte auch etwas Besonderes haben, nicht more of the same, was ich schon bei den Privaten kriegen kann. Außerdem hat der Staat, wie ich glaube, für das „Lebensmittel Kunst, Kultur, Medien und Journalismus“ auch Plattformen zu bieten.
Bleiben wir kurz beim Vergleich zwischen einem Pay-Kanal wie zum Beispiel HBO und dem ORF. Es gibt natürlich Parallelen. Aber ein privat finanziertes Abomodell wie bei HBO kann ich kündigen, die ORF-Gebühr muss ich hingegen bezahlen, wenn ich ein empfangsfähiges Gerät habe. „Zwangsgebühr“ wird das von den Gegnern genannt …
G. M.: Ich habe das deshalb erwähnt, weil es für mich eine Art besonderen Inhalts formuliert. So wie in Dänemark zum Beispiel die außergewöhnliche Politik-Serie Borgen entstanden ist, in Deutschland funk.net, oder wie es im ZDF „Terra X“ als Dokureihe im Hauptabendprogramm am Sonntag oder „37 Grad“ gibt. Letzteres ist wahrlich kein fröhliches Programm, das sind human interest stories, die trotzdem von einem jungen Publikum angeschaut werden. Und im Netz haben Pay-Plattformen, auf denen früher eben Dexter oder Six Feet Under entstanden sind, mit jungen Regisseurinnen und Regisseuren gearbeitet, die von den Filmhochschulen kamen und etwas ausprobieren durften. Ich wollte zum Ausdruck bringen, dass es nicht um ein werbegetriebenes Programm geht, wo du bloß etwas Erfolgreiches zu kopieren versuchst, sondern um ein inhaltsgetriebenes Angebot. Und da sind für mich diese zwei Programmplattformen sehr vergleichbar.
Wobei man hier etwas einwenden könnte: Die zwei ersten HBO-Kultserien hießen „Oz“ und „The Sopranos“. Erstere hat es damals leider nicht zu uns geschafft, lief aber vor ein paar Jahren auf Sky und ist auf Disc erhältlich. „Die Sopranos“ dagegen sind damals im ORF als erste horizontal erzählte Serie, bei der man sich eigentlich nicht auskennt, wenn man irgendwo zwischendrin einsteigt, auch sehr erfolgreich geworden. Die Schöpfer dieser Serien, wie z. B. Tom Fontana, hatten sicherlich freie Hand, waren aber keine Einsteiger, sondern hatten vorher im werbefinanzierten Fernsehen ihre Meriten verdient.
G. M.: Ja, ich habe auch nichts gegen etablierte Leute – Alter ist ja kein Qualitätskriterium. Aber mir persönlich, um auch Namen zu nennen, gefällt die Erzählhaltung eines Andreas Prochaska, der sich ständig weiterentwickelt, besser als das sich über Jahrzehnte ähnelnde Angebot eines Robert Dornhelm. Und das ist für mich der Unterschied: Der eine hat Maximilian gemacht, der andere Maria Theresia und beides ist öffentlich-rechtlich finanziert. Maria Theresia muss aber nicht öffentlich-rechtlich finanziert sein, so wie es gemacht wurde.
Das heißt also, mit dem ORF-Gebührengeld sollte sorgfältiger umgegangen werden?
G. M.: Genau! Man sollte aber jedenfalls das vorhandene Geld in die Branche investieren. Es sind trotz der Sparvorhaben des Generaldirektors 40 Millionen Euro für die Olympischen Spiele und die Fußball-EM im kommenden Jahr vorgesehen. Da geht es um reine Lizenzgelder und um Einmalereignisse, also um nicht wiederholbaren Content. Dazu wird es nächstes Jahr die nordische und die alpine Ski-WM geben. Sport noch und nöcher!
Viele Menschen mögen viel Sport im ORF, nicht?
G. M.: Ich will ja auch nicht gegen den Sport bashen – ich bin selbst Rapid-Abonnent und gehe regelmäßig zu den Heimspielen –, aber ich möchte deutlich machen, dass die Verhältnismäßigkeit nicht mehr stimmt. Unlängst beim Kauf der Bundesliga-Geisterspiele schenkt der ORF dem Pay-Sender Sky Millionen Euro für etwas, das er nie wieder verwenden wird können; da würde ich doch das Geld lieber in eine Dokumentation, in eine fiktionale Serie, ein Erzählprogramm investieren!
Und dasselbe gilt Ihrer Meinung nach für die Übertragungsrechte an den genannten Sport-Großereignissen?
G. M.: Wenn ich zum Beispiel sage, ich nehme diese 40 Millionen nicht für die Fußball-EM und die Sommerspiele, sondern ich beteilige mich damit zu 20 Prozent an Film- oder Serienprojekten. Das ist ein durchaus üblicher Prozentsatz, den der ORF heutzutage bei einer Serie oder bei einer Dokumentation zum Gelingen beiträgt. Der Rest kommt über Förderungen, Produzentengelder oder ausländische Fernsehanstalten bzw. Medienplattformen. Dann kann man aus diesen 40 Millionen 200 Millionen Programmvolumen machen, bei dem man redaktionell mitreden kann. Das hieße nichts anderes, als dass ich jeden Tag dieses Jahres mehr als 500.000 Euro ins Programm stecken könnte – nämlich wiederholbares Programm! Das ist doppelt wertvoll. Nicht nur, dass die Kreativwirtschaft damit gefördert wird, sondern ich habe auch meinen Archivwert gesteigert und ich bin finanziell so potent, dass ich auch Innovatives und nicht nur den Mehrheitsgeschmack herzustellen in der Lage wäre. Das wäre mein Hauptanliegen. Sie müssen sich vorstellen, dass der ORF in Sportrechte rund zwanzig Mal soviel Geld investiert wie z.B. in sein gesamtes Kinderprogramm – da gibt es eine Unverhältnismäßigkeit, die der Branche sehr schadet, weil eben von den Sportrechten niemand profitiert.
Weil Sie „Borgen“ erwähnt haben: In einem vergleichbaren Land wie Österreich entstanden, und doch scheint so etwas in Österreich nicht möglich zu sein. Eine Qualitätsserie zu produzieren, die auf unterhaltsame Weise Einblicke in die Grundstrukturen der politischen und medialen Prozesse einer Demokratie gibt.
G. M.: Ja, und wenn wir das ausweiten auf den non-fiktionalen Bereich, der ja viel preisgünstiger ist und wo es daher gar nicht am Geld liegen kann: Da liegt es wirklich an den Slots. Wir haben zu wenige Sendeplätze für Human Interest. Wir haben Reportagen beim „Schauplatz“ und wir haben in „kreuz und quer“ die eine oder andere Geschichte, oder bei „Thema“. Aber das ist alles sehr stark formatiert. Der ORF meint sogar, die Feuerwehr in eine Attraktion umwandeln zu müssen (gemeint ist die ORF-Show „Feuer und Flamme“). Ich dagegen glaube, die Katastrophen, die Schicksalsschläge und die besonderen Momente, die man bei der Freiwilligen Feuerwehr erlebt, sind für sich schon spannend genug. Die muss ich nicht tunen! Das machen schon die Privatsender. Überhaupt orientiert sich der ORF in seinem Auftritt offenbar immer noch an der privaten TV-Konkurrenz und nicht an der digitalen Welt. Das ist nicht mehr zeitgemäß! Der ORF schaut immer noch so aus, wie er von Gerhard Zeiler vor Jahrzehnten hingestellt wurde.
Dem würden jetzt natürlich einige massiv widersprechen.
G. M.: Die Strukturen, wo der ORF noch funktioniert, sind meines Erachtens im Kern Zeiler-Projekte. Der hat damals viel richtig gemacht. Mir fehlt aber jetzt die Reaktion auf die Plattformen, auf hybride Formate, auf ein Bemühen, wie ich kuratiertes Programm machen kann, das sich nicht über die Kopie von Erfolgsformaten aus anderen Ländern formuliert, sondern aus unserem eigenen Land heraus.
Digitale Erfolgsformate, andere Länder, Modernisierung – da fällt einem der ORF Player ein, der seit einiger Zeit als neue Streaming- und Social-Media-Plattform entwickelt wird und kommenden Sommer starten soll.
G. M.: Bei der Entwicklung des Players habe ich allerdings zwei große Fragen, die ich noch nicht beantwortet bekommen habe. Erstens: Welchen Content produzieren wir gerade für diesen Player? Weil ein technisches Abrufgerät ist leicht zu ermöglichen, aber was werde ich dort sehen, was ich woanders nicht sehen kann und nach welchen kuratierenden Momenten? Und das Zweite, wenn ich mit einer Zeitschrift wie „ray“ spreche: Denkt irgendwer daran, die Kreativen auch entsprechend zu bezahlen, dass das dort ausgestrahlt wird?
Um beim Inhalt zu bleiben, weil Sie vorhin funk.net erwähnt haben, die Content-Plattform von ARD und ZDF für junge Nutzer: Könnte das ein Vorbild für den ORF-Player sein?
G. M.: Das würde ich mir wünschen. Da werden Doku-Formate für Zwanzigjährige entwickelt oder ehemalige YouTuber in einer Videoform begleitet. Da sieht man körperlich schwer beeinträchtigte junge Frauen, die trotzdem nicht aufgeben. Filme, in denen man nicht nur schön und attraktiv ist, sondern wo man das Leben zu bewerkstelligen hat. Ich glaube, dass wir da viel Nachholbedarf haben. Am allermeisten, und da schließt sich dann der Kreis, wenn es um den Mediaplayer geht, brauchen wir an der Spitze des ORF wieder Journalisten und Programm-Menschen, sonst sind da nur mehr Verwalter, Technokraten und Kaufleute tätig.
Gerhard Weis zum Beispiel war noch Journalist, der hat die Radioreform durchgebracht, davon profitieren wir im Radio genauso, wie wir im Fernsehen auf den Strukturen von Gerhard Zeiler aufbauen. Jetzt ist Zeit für jemanden, der digital denkt. Aber was ist das digitale Narrativ? Das hat das Storytelling total verändert, darüber muss man sich intensiv Gedanken machen. Wir brauchen im ORF wieder mehr Menschen, die Geschichten erzählen wollen und die sich journalistisch bzw. kuratorisch den Programmformaten annähern.
Man sollte sich mehr trauen und Leuten etwas zutrauen …
G. M.: Genau! Dabei geht es jetzt nicht darum, dass man Jugendmagazine macht, das ist wahrscheinlich nicht mehr zeitgemäß, sondern es geht um Programmflächen, auf denen etwas ausprobiert wird – und die dürfen auch scheitern. Das Scheitern ist in Österreich und in weiten Teilen Europas etwas, das einem nicht unbedingt zugestanden wird. Das wäre aber nötig und daher ist eine meiner wichtigsten Forderungen, dass es solche Flächen gibt. Es ist ja auch so, dass die meisten Autoren fiktionaler Fernsehstoffe in Österreich praktisch nur anfangen können, indem sie für ein vorgegebenes Format schreiben. In den seltensten Fällen darf man ein neues Format entwickeln. Diese fehlende Möglichkeit ist etwas, wo der ORF Flagge zeigen muss.
Und dabei entsteht dann etwas Wertigeres als die Wiener Variante von „Desperate Housewives“?
G. M.: Die Gewissheit habe ich nicht, aber ich glaube, dass wir die Rahmenbedingungen verbessern und auch in vielen anderen Bereichen unserer Gesellschaft Initialzündungen zulassen müssen: Zum Beispiel: Warum haben wir auf 2015 nicht mit einer Sitcom aus Traiskirchen geantwortet?
Weil das ein sehr heikles politisches Thema war?
G. M.: Das ist der Mangel an redaktioneller Kompetenz in der ORF-Geschäftsführung. Der gesellschaftliche Diskurs findet nicht in den Nachrichten, sondern in den fiktionalen und nonfiktionalen Formaten statt. Anderes Beispiel: Wenn ich eine Statistik über ungewollte Schwangerschaften in den Nachrichten veröffentliche, geht das in das ins Ohr rein und wieder raus. Wenn ich eine 30-minütige Reportage über eine 14-Jährige mache, wird das unglaublich viel auslösen bei Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, ob als Angehörige oder Betroffene. Wir sollten gesellschaftspolitisch unterwegs sein und haben diese Dinge in den öffentlich-rechtlichen Formaten aufzugreifen. Denn das Narrativ als solches hat sich zum exemplarischen Narrativ verändert. Wichtig ist also, dass Platz für Porträts, Biografien oder Schicksale zur Verfügung steht. Das ist so erfolgreich, weil ich mich im Schicksal des anderen wiederfinden kann. Ein auf einer wahren Geschichte beruhender Film ist doppelt so viel wert wie ein gänzlich erfundener.
Wie man an der derzeitigen Dokuserienflut z.B. auf Netflix erkennen kann, sind sehr viele Menschen offenbar an wahren Verbrechen interessiert.
G. M.: Ich finde, es ist ein eindeutiges Unterscheidungsmerkmal, dass der ORF die Sachen, die der private Markt hervorbringt, nicht auch machen muss! Der Sozialvoyeurismus soll dort stattfinden! Ich müsste eher überlegen, wie ich etwas entwickle, das von anderen kopiert wird. Das führt mich zur Notwendigkeit, dass wir proaktiv Einzelstücke fördern müssen, aber bei Serien für die Vielfalt eintreten. Wäre ich ORF-General, würde ich die fiktionale Serienherstellung auf zwei Staffeln begrenzen. Danach könnte das jemand anders weiterproduzieren, und der ORF hätte die Ressource, das nächste Sujet zu entwickeln. Bei Erfolg einmal nachlegen ist in Ordnung – 20 Jahre Soko Kitzbühel ist ein Witz!
Vor ein paar Wochen gab es im ORF einen Dok-1-Film von Hanno Settele über die Determinationsmacht des Erbens in Österreich, so etwas hat man selten gesehen.
G. M.: Die Dok-1-Schiene ist eines der wenigen positiven Beispiele. Die bemüht sich in einer bestimmten Bildsprache und Ästhetik, übrigens in einer personalisierten Form, wichtige Themen aufzugreifen. Es gibt viele Themen, zumal in den Bundesländern, die den Verantwortlichen zu heiß sind – da sind wir nun bei den Landesstudios. Ich glaube, die ergeben nur dann Sinn, wenn sie überregionale Aufgaben bekommen. Wenn sie weiter in diese Landeshauptmann-Landeshauptfrau-Berichterstattung gezwungen werden und noch mehr Provinznachrichten bringen müssen, dann wird sich dort die Qualität des Journalismus nicht verändern können. Dann wäre ich dort als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter auch bald ziemlich verzweifelt.
Die Landesstudio-Struktur würden Sie also auch massiv verändern?
G. M.: Der ORF sollte das Gegenteil von dem tun, was er gerade macht: Er sollte nicht zentralisieren, sondern die Ressourcen verteilen und die Möglichkeiten nützen, die die Landesstudios haben. Warum ist ORF SPORT + nicht in Innsbruck? Warum ist ORF III nicht in Salzburg? Warum entsteht in Linz kein Wissenschafts- und Zukunfts-Cluster? Warum habe ich in Graz keine Mitteleuropa-Redaktion? Und verlege Hauptabteilungen von den Fachredaktionen in die einzelnen Bundesländer?
Und das Zentrum in Wien könnte überlegen, europäischer zu werden. Mein persönliches Faible aufgrund der Lage Ostösterreichs ist die Chance, dass wir den Journalismus einer liberalen Demokratie und das Verständnis eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch mit unseren Nachbarn teilen. Das wird nur durch Kooperationen passieren. Es ist hilfreich für die Entwicklung freier Medien, wenn Länder, die das schon haben, anderen beim Aufbau helfen. Zum Beispiel könnten wir – das erfordert aber politischen Willen und nicht nur den der Geschäftsführung – Teile des Programms in Kroatisch, Serbisch oder Tschechisch parallel ausstrahlen. Vor geraumer Zeit haben Mitterrand und Kohl ARTE gegründet. Ich glaube, wir wären heute in der Lage, ein Bundesland Heute für 40 Millionen Menschen in Ost- und Mitteleuropa herzustellen.
Das klingt kühn, leuchtet aber auch ein.
G. M.: Eine vielleicht weniger kühne Forderung, die der ORF zu erfüllen hat: Die barrierefreie Ausstrahlung für Seh- und Hörbehinderte sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Es ist ein Skandal, dass eine öffentlich-rechtliche Einrichtung das nicht ermöglicht! Stattdessen verliert sie laufend an Relevanz: Mit ORF eins wurde fast nichts anderes getan, als sich mit Sport und internationalen Lizenzprogrammen an ein Mehrheitspublikum anzubiedern. Der ORF muss sich aber als Kulturgut verstehen. Der ORF ist das größte Kultur-Unternehmen Österreichs. Er ist nicht nur Berichterstattung über Kultur, er ist Kultur! Nicht nur Hochkultur, sondern auch urban culture und ähnliches. Dafür sollte mehr Geld in die Hand genommen werden, dafür sollten Ressourcen eingesetzt werden, das ist meine tiefe Überzeugung.