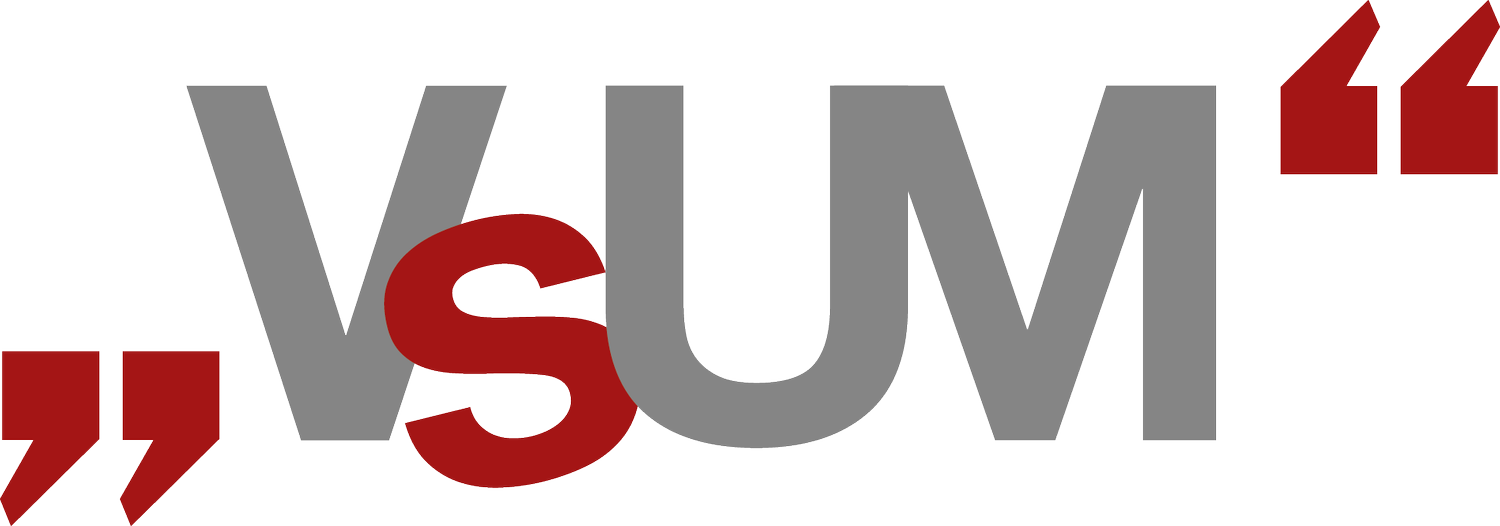»Beim Umgang mit der eigenen Psyche werden Kinder ziemlich alleingelassen«
Von Clemens Paulovics, 2. Heft 2025, aus engagement
Interview mit Golli Marboe, Initiator der »mental health days« an Österreichs Schulen
Die psychische Gesundheit von Kindern und jungen Erwachsenen wird oft noch übersehen – mit dramatischen Folgen, die Golli Marboe selbst erleben musste. Mit dem Projekt »mental health days« in Österreich will er deshalb ein Bewusstsein bei Schülerinnen und Schülern für ihr eigenes Wohlbefinden schaffen und dies altersgemäß aufbereiten. Im Interview erläutert er, wie er »gesunde« Heranwachsende auf mentale Herausforderungen vorbereitet.
Clemens Paulovics: Herr Marboe, Sie sind ja grundsätzlich Medienmacher und Medienexperte. Was hat Sie für das Thema »Psychische Gesundheit« sensibilisiert, wie sind Sie auf die Idee zu den »mental health days« gekommen?
Golli Marboe: Es ist inzwischen sechs Jahre her, dass sich eines meiner Kinder, mein Sohn Tobias, das Leben genommen hat. Er war damals 29 Jahre alt. Natürlich ist nichts mehr so, wie es war. Wir alle, seine Freundinnen und Freunde, wir die Familie, wir stellen uns Tausende Fragen: »Was haben wir übersehen?« – »Was hätten wir besser machen können?« – »Warum haben wir nicht gespürt, dass Tobias nicht einfach nur ›schlecht drauf war‹, sondern eine schwere Krankheit hatte?« »Warum hat denn auch Tobias irgendwann uns nicht mehr lesen können – natürlich hätten wir uns bemüht, ihn zu unterstützen – so gut wir es eben geschafft hätten?« Wir werden auf diese Fragen keine Antworten bekommen. Aber einen Befund gibt es seit damals, sowohl im Freundeskreis von Tobias als auch bei uns in der Familie: Wir wussten zu wenig über Fragen des psychischen Wohlbefindens! Denn wenn er sich beim Sport verletzt hätte, etwa beim Fußball das Bein gebrochen, dann hätte jede und jeder in unserer Gesellschaft gewusst, was es zu tun gibt: Rettung rufen, Unfallkrankenhaus, Röntgen, vielleicht einen Gips, zwei Wochen später eine Kontrolle. Aber was soll man machen, wie soll man sich verhalten, wenn ein Mensch über Wochen trübsinnig ist, wenn jemand nicht mehr aus dem eigenen Zimmer oder der kleinen Wohnung herauskommt, und ganz krass: Wie reagiert man, wenn ein Mensch, den man gut kennt und man weiß, dass dieser Mensch intelligent und sozial kompetent ist, dann trotzdem Dinge sagt, die nicht stimmen können? Für diese Situationen waren wir nicht vorbereitet, da hatten wir keine wie immer gearteten Informationen oder Routinen!
Clemens Paulovics: Das heißt, Sie wollen mit den »mental health days« mehr Bewusstsein schaffen für Themen rund um psychische Belastung und Erkrankung und diese enttabuisieren?
Golli Marboe: Ja genau, das ist der Grund und der Anlass, warum es die »mental health days« gibt. Und ich empfinde auch einen Auftrag meines Sohnes Tobias. Er hat am Tag seines Suizids zu mir gesagt: »Papa, bitte schau drauf, dass niemand so traurig wird, wie ich es geworden bin.« Mit unserem Angebot verfolgen wir drei Ziele: Wir möchten einen kleinen Beitrag leisten, dass die Sichtbarkeit des Themas »psychisches Wohlbefinden« verbessert wird; wir möchten einen kleinen Beitrag leisten, dass man über Gefühle zu sprechen lernt, und wir wollen vor allem die vielen Hilfseinrichtungen bekannter machen, die bereits existieren.
Clemens Paulovics: Das sind große Ziele! Könnten Sie uns ein wenig Einblick geben, wie Sie die Kinder und Jugendlichen an diese ungewohnten, tabubesetzten Themen heranführen? Da braucht es, denke ich, einen niederschwelligen Einstieg?
Golli Marboe: Wir beginnen jedes unserer Module der »mental health days«mit der Frage: »Wer von euch hat heute schon Zähne geputzt?« Praktisch alle Schüler*innen heben die Hand – sie meinen, sie hätten heute schon Zähne geputzt. Dann stellen wir die Frage: »Wer von euch hat heute schon über die eigenen Gefühle nachgedacht?« – und kaum ein junger Mensch hebt die Hand. Woher sollen sie es auch wissen? Woher sollen sie ein solches morgendliches Ritual auch kennen? Dass man in der Früh vielleicht nicht nur Zähne putzt, sondern auch darüber nachdenkt »Wie wird der Tag – freue ich mich auf das, was kommt? Vielleicht, weil ich frisch verliebt bin? Oder mache ich mir Sorgen, weil jemand in meinem Umfeld gemobbt wird und ich nicht so genau weiß, wie ich helfen kann?« Das Zähneputzen wird uns allen erklärt, aber beim Umgang mit der eigenen Psyche lassen wir unsere Kinder einfach so »hineinpurzeln«, da lassen wir sie ziemlich alleine!
Clemens Paulovics: Das klingt tatsächlich nach einem sehr unkomplizierten Zugang. Zu welchen Themen genau wird nun im Rahmen der »mental health days« in den Schulen gearbeitet?
Golli Marboe: Wir haben in enger Zusammenarbeit mit unserem wissenschaftlichen Beirat acht in Schulen besonders relevante Themen festgeschrieben, die in extremis zu einem Suizid führen könnten. Es sind acht Themen für die acht Schulstufen der Sekundarstufe des österreichischen Bildungssystems; diese in altersgerechter Form aufgearbeiteten Jahresthemen richten sich also an Kinder und Jugendliche nach der Volksschule (Grundschule) vom 11. bis zum 20. Lebensjahr. Im ersten Jahrgang geht es um Mobbing, im Jahrgang darauf dann um Körperbild und Essstörungen. In der dritten Schulstufe, also im siebten Schuljahr, wird das Thema Handysucht bearbeitet, in der vierten Leistungsdruck und Prüfungsangst – nicht zuletzt deshalb, weil im österreichischen System nach der achten Schulstufe die Entscheidung getroffen werden muss, in welchen weiterführenden Schultyp oder in welche berufliche Ausbildung man dann weitergeht. In den Oberstufen- und Berufsschulen beginnen wir mit dem Thema Sucht für die Vierzehnjährigen: Da legen wir den Schwerpunkt nicht zuletzt auf den Umgang mit Alkohol. In der zehnten Schulstufe geht es um Depression, in der elften um Suizidalität und in den Maturaklassen(Abiturklassen) um Ängste.
Clemens Paulovics: Wie kann man sich den Ablauf eines solchen Moduls vorstellen, wird da einen ganzen Tag zum jeweiligen Thema gearbeitet?
Golli Marboe: Sämtliche unserer Module sind nach dem gleichen Muster aufgebaut. Es gibt eine Moderatorin oder einen Moderator – in der Regel ein Erfahrungsexperte, beispielsweise jemand, der selbst einen Verlust in der Familie zu bedauern hatte, oder wir hatten eine ehemalige Balletttänzerin, in deren Company in der Wiener Staatsoper Anorexie ein Dauerthema war, etc. … Und die Moderation führt durch ein Modul, das genauso lang ist wie eine Schulstunde – nämlich 50 Minuten. In dieses Modul, das gegliedert ist durch eigens hergestellte Videos und Folien, werden die Kinder und Jugendlichen durch die interaktive App »Mentimeter« (mentimeter.com) aktiv in den Workshop mit einbezogen. Die von erfahrenen Journalist*innen gestalteten Videos erläutern einerseits das Thema des Workshops, beispielsweise durch eine Definition der WHO, lassen andererseits aber auch Peers zu Wort kommen: So spricht in einem Video der Musiker und Produzent RAF Camora über eine eigene Depression oder aber in einem Zuspieler über Suizidalität hören wir Billie Eilishs Gedanken über ihre suizidalen Krisen. Die Partizipation der Schülerinnen und Lehrlinge mittels »Mentimeter« bietet die wunderbare Möglichkeit, dass sämtliche Kinder und Jugendlichen zu Wort kommen, denn anders als beispielsweise in einem Setting mit einem Sesselkreis können bei »Mentimeter« auch die Stilleren, die Leiseren, die Außenseiter formulieren, wie es ihnen geht. Und dann finden diese sonst möglicherweise übersehenen, schweigsameren Schülerinnen und Schüler deren Gedanken auf der Projektionswand in gleichwertiger, gleichberechtigter Größe wieder wie die Statements der sonst »üblichen Verdächtigen«, der lauteren Kolleg*innen.
Clemens Paulovics: Welche Rolle kommt den Expert*innen in den Workshops zu?
Golli Marboe: Nun, zunächst möchte ich festhalten, dass neben dieser großartigen Möglichkeit, dass trotz der begrenzten Zeit jedes Workshops tatsächlich alle zu Wort kommen können, ein zweiter nicht minder wertvoller Effekt entsteht: Die Außenseiter*innen sehen durch die auf der Leinwand projizierten Statements, dass sie ja gar nicht die Einzigen sind, denen es möglicherweise gar nicht so gut geht – da gibt es auch noch andere! Die von den Teilnehmenden völlig anonym formulierten Antworten auf Fragen wie: »Was ist dir das Wichtigste im Leben?« oder »Was macht dir den meisten Druck im Leben?« werden dann von der Moderatorin aufgegriffen und in einer Doppelconference mit einem Fachexperten oder einer Fachexpertin weiter besprochen. In jedem unserer Module steht nämlich auch noch eine klinische Psychologin, ein klinischer Gesundheitspsychologe sowie eine Psychotherapeutin oder ein Psychotherapeut vor Ort zur Verfügung. Die »mental health days« arbeiten mit dem »Verband der Psychotherapeut*innen«, dem »Verband der Psycholog*innen« und dem »Verband der kritischen Psycholog*innen« zusammen. Daher ist auch das schnelle Wachsen der »mental health days« möglich, weil wir mit Mitgliedern dieser Verbände aus ganz Österreich zusammenarbeiten können. Wir arbeiten grundsätzlich mit diesen Universalisten, damit wir auch auf möglichst viele unterschiedliche Fragen/Anregungen und Anmerkungen der jungen Erwachsenen eingehen können. Durch die lokale Sprachfärbung der Fachexpertinnen wird außerdem die Beziehung zu den Schüler*innen niederschwelliger. Darüber hinaus bieten die Psychotherapeut*innen und Psycholog*innen für die Schulen auch die Gewissheit, dass die Qualität der angebotenen Impulse auf dem höchsten Niveau stattfindet.
Clemens Paulovics: Wie kann denn nach den »mental health days« an den Schulen weitergearbeitet werden? Oder, anders gefragt: Was bleibt an den Schulen?
Golli Marboe: Im Team gibt es neben der Moderatorin und der Fachexpertin noch eine dritte Person, die vor Ort in den Schulen tätig ist: Diese gestaltet live neben der Präsentation der Videos, der Folien und der Umfragen mittels »Mentimeter« auch noch ein »graphic protocol«. Diese Künstler*innen halten in »comicartiger« Form die wichtigsten Gedanken zu den vorgestellten Themen auf einem Plakat fest. Diese visuellen Protokolle bleiben dann auch als Andenken, als »Reminder« und als Geschenk in den Schulen. Darüber hinaus wird an jeden Schüler, jede Schülerin auch ein eigens von den »mental health days« hergestellter Flyer mit den wichtigsten Adressen der Hilfseinrichtungen des jeweiligen Bundeslandes ausgeteilt. Diese Flyer werden vor jedem Workshop auf die Sessel der Teilnehmer*innen gelegt. Die »mental health days« richten sich »nicht nur« an Kinder und Jugendliche, die schon ein Thema mit ihrer mentalen Gesundheit haben, sondern ganz besonders an junge Erwachsene, die »gesund« sind. Und unsere Flyer dienen dementsprechend ganz konkret dazu, dass die Kinder und jungen Erwachsenen – sollten sie selbst einmal in eine Krise kommen – nicht dann erst beginnen müssen, nach einer seriösen Quelle zu suchen. Die redaktionelle Auswahl der auf den Flyern angeführten Hilfseinrichtungen entsteht in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Bildungsdirektionen der Bundesländer und den regionalen Telefonseelsorgen. Es handelt sich dabei ausschließlich um Hilfsangebote, die gegebenenfalls auch anonym und jedenfalls kostenlos kontaktiert werden können.
Clemens Paulovics: Insgesamt kann man die »mental health days« wohl als recht niederschwelliges Angebot sehen – sowohl für die Schulen in der Organisation als auch inhaltlich für die Schüler*innen?
Golli Marboe: Genau. Jede Schülerin, jeder Schüler »verliert« im Zuge eines »mental health days« nur eine Schulstunde. Der Lehrplan wird also nicht wirklich gestört. Die relative Kürze der einzelnen Module unserer »mental health days« trägt hoffentlich dazu bei, dass die Kinder, die jungen Erwachsenen, die an einem Modul der »mental health days« teilgenommen haben, im Anschluss an diese Stunde gerne mehr zum Thema erfahren möchten. Die verschiedenen Klassen des gleichen Jahrgangs fassen wir in einem Modul zusammen. Bis zu hundert Kindern wird das gleiche Programm geboten – in der Anmutung vielleicht eher wie eine Kino- oder Theaterveranstaltung und keinesfalls wie eine Therapiestunde. Alle unsere Workshops sind außerdem »offene« und keine »sicheren« Räume, denn es geht nicht um Therapie, es geht nicht um die Öffnung oder Eröffnung intimer Gedanken, sondern um ein »mental health literacy«-Projekt: Es geht darum, Wissen über mentale Gesundheit zu kommunizieren und dadurch Tabus abzubauen – vielleicht sogar das eine oder andere Stigma aus der Welt zu räumen.
Clemens Paulovics: Das Angebot der »mental health days« ist ja grundsätzlich gratis – welche Bedingungen gibt es für Schulen, die mitmachen wollen?
Golli Marboe: Für Schulen, die sich für die »mental health days« interessieren, gibt es die Bedingung, dass sämtliche Schüler*innen der jeweiligen Bildungseinrichtung am gleichen Tag einen Workshop erhalten: Beispielsweise gibt es in der ersten Stunde ein Modul für alle Zehnjährigen zum Thema Mobbing, in der zweiten Stunde für alle Zweitklässler*innen der Schule eine Veranstaltung zum Thema Körperbild und Essstörungen und so weiter. Teil des Konzeptes ist es darüber hinaus, in jede dieser Schulen im nächsten Jahr wiederzukommen – das bedeutet, die Kinder und Jugendlichen haben jedes Jahr einen Impuls, und das immer zu einem nächsten Thema. Wir laden übrigens die Vertrauenslehrer*innen, die Schulsozialarbeiter*innen, die Schulpsycholog*innen, die Schulärzt*innen und alle anderen im Schulverband als »Schulsupportpersonal« bezeichneten Personen ein, gerne bei all den Modulen für die Schüler*innen persönlich auch dabei zu sein. Nicht nur, weil es durchaus auch unter den Erwachsenen einige gibt, die zu den beschriebenen Themen gar nicht so viel wissen, sondern vor allem, damit nochmals unterstrichen wird, dass man über diese Themen offen sprechen kann – egal, wer im Raum ist, ziemlich egal, wer da gerade zuhört – es sollte nicht peinlich sein, über Fragen des psychischen Wohlbefindens zu reden. Es ist ja auch in den seltensten Fällen peinlich, über eine Blinddarmentzündung zu sprechen! Neben den »Mentimeter«-Fragen findet als zusätzliches partizipatives Element in jedem der Module eine interaktive Aktion statt. Es kann sich um eine Achtsamkeitsübung handeln, wie beim Thema Handysucht, wenn wir die Kinder einladen, eine (zuckerfreie) Schokoladewaffel mit allen Sinnen in sechs Schritten zu genießen und eben nicht hinunterzuschlingen.
Clemens Paulovics: Sie haben gerade eben auch die Erwachsenen angesprochen. Welche Angebote bieten die »mental health days« für sie?
Golli Marboe: Am Nachmittag der »mental health days« findet in jeder Schule eine Weiterbildung für Pädagog*innen und abends eine Veranstaltung für die Erziehungsberechtigten statt; Schwerpunktthemen dabei sind Selfcare und Abgrenzung. Darüber hinaus werden in diesen beiden Modulen die Ergebnisse unserer »mental health days Studie ’24« präsentiert.
Clemens Paulovics: Wie ist diese Studie aufgebaut? Wer ist Kooperationspartner?
Golli Marboe: Die zu diesem Themenkreis wohl größte wissenschaftliche Studie Österreichs entsteht in Kooperation mit der Universität Wien. Die Studie wurde durch die Ethikkommission der Universität Wien geprüft und freigegeben. Wir untersuchen dabei mittels eines aus rund 60 Fragen bestehenden Fragebogens die Wechselwirkung von Medienverhalten und psychischer Gesundheit. Die Studie wurde im Rahmen der »mental health days« durchgeführt: Die Schüler*innen haben den Fragebogen online unter Aufsicht selbst ausgefüllt; die Teilnahme war freiwillig und durfte jederzeit abgebrochen werden. Im vorigen Kalenderjahr 2024 erhielten wir 14.500 vollständig ausgefüllte Fragebögen. In multipler Regression bestimmten wir dabei potenzielle Effekte der Mediennutzung auf Lebenszufriedenheit. Die Effekte wurden kontrolliert für zwölf soziodemografische Variablen, wie Alter, Geschlecht, Einkommen, Größe u. v. m. Ein erster Überblick zu den Medieneffekten auf die Lebenszufriedenheit zeigt, dass Seiten sozialer Netzwerke und Streaming vermutlich negative Effekte auf die Lebenszufriedenheit haben; die Effekte von sozialen Netzwerkseiten sind klein, aber relevant. Effekte von Videospielen, Messenger-Nutzung, Lesen und AI sind hingegen irrelevant. Weitere Informationen zu den Ergebnissen der Studie findet man auf der Seite der »mental health days« (https://www.mentalhealthdays.eu).
Clemens Paulovics: Wollen wir abschließend noch über die Finanzierung und Unterstützung dieser Initiative eingehen: Wie sieht es da aus? Gibt es große Bereitschaft, die »mental health days« zu unterstützen, ist die Sensibilität bei den öffentlichen Stellen schon ausreichend erkennbar?
Golli Marboe: Die »mental health days« werden von acht Bildungsdirektionen, drei Ministerien, zwei Medizinischen Universitäten und zahlreichen anderen renommierten Institutionen aus der Welt der Bildung und der Gesundheit ideell unterstützt. Diese Unterstützung ist wichtig, um die Vision des Projektes zu verwirklichen: Im Jahr 2030 soll es an jeder österreichischen Schule der Sekundarstufe 1 und 2 ein Mal im Jahr einen »mental health day« geben. Lediglich die Finanzierung des Projektes ist schwierig und mühsam, denn Prävention ist schwierig zu messen. Und Förder- wie Sponsorengelder müssen mit entsprechenden Zahlen belegt werden. Aber wie sagte mein Sohn Tobias in einer seiner Bild-Text-Collagen: »Die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, weil die Hoffnung gar nicht sterben kann!«
Clemens Paulovics: Herzlichen Dank für das Gespräch und viel Erfolg weiterhin für Ihr Projekt!
Ernst »Golli« Marboe ist Journalist und Medienexperte, Autor und Dozent, Vater von vier Kindern, Initiator der »mental health days«. Auf 365.vsum.tv führt er seit Jahren einen Podcast, in dem unter anderen schon viele Expert:innen aus Psychologie und Pädagogik und auch einige Ordensleute zu Wort gekommen sind. Sein Buch »Notizen an Tobias. Gedanken eines Vaters zum Suizid seines Sohnes« ist erschienen.
Von Clemens Paulovics, 2. Heft 2025, aus engagement