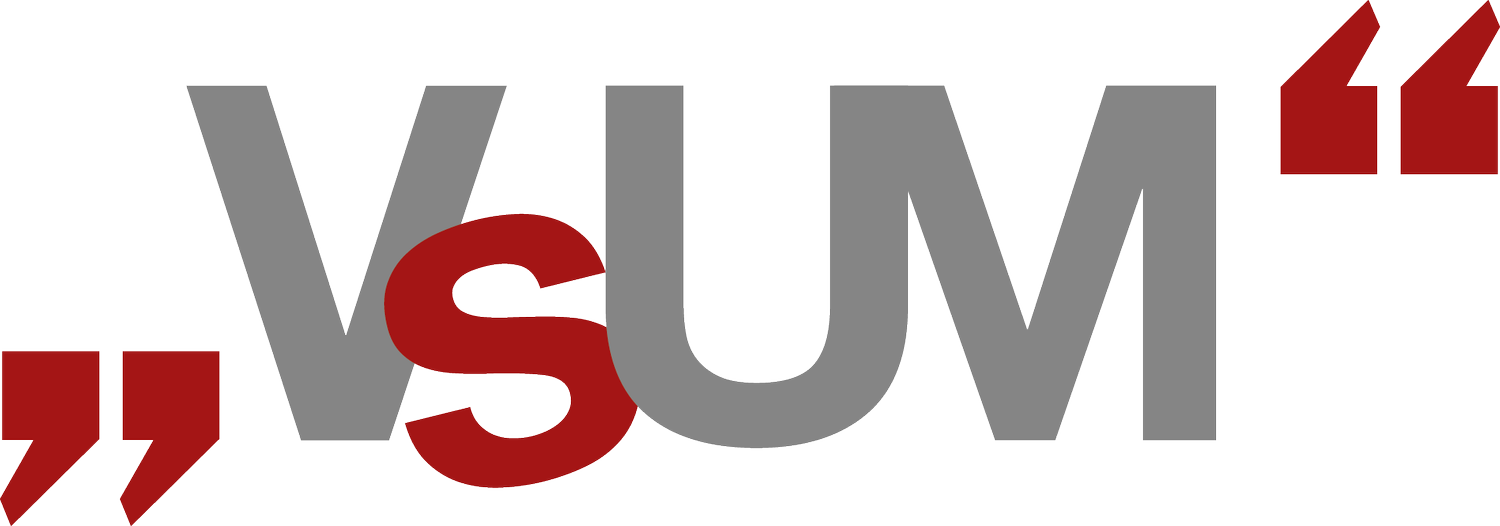Wer soll als Nächste(r) im ORF-Chefsessel sitzen?
Wer soll als Nächste(r) im ORF-Chefsessel sitzen?
Im August bestellt der Stiftungsrat eine neue ORF-Führung. Wrabetz tritt wieder an. Welche Persönlichkeiten noch spannend wären.
Von Golli Marboe, Erstveröffentlichung: Die Presse am 16. Juni 2021(c) Peter Kufner
Alexander Wrabetz hat seine neuerliche Kandidatur für die anstehende Bestellung zum ORF-Generaldirektor am 10.August bereits angekündigt. Wird er bestellt, würde er seine vierte Amtszeit seit 2006 beginnen. Es braucht jedenfalls auch Alternativen – wer könnten jene Persönlichkeiten sein, die sich neben dem amtierenden ORF-Chef für diese Aufgabe bewerben?
In keinem anderen Job des Landes trägt man mehr Verantwortung für die Qualität des Journalismus und für die Innovationskraft der Kreativbranche.
Aus dem ORF selbst sollten jedenfalls folgende Persönlichkeiten ihre Ideen und Vorschläge für die Zukunft der größten Medienorgel des Landes im Rahmen eines öffentlichen Hearings präsentieren:
• Roland Weißmann: Der „türkise“ Kandidat mit Ausbildung im Landesstudio Niederösterreich, enger Vertrauter und rechte Hand des ehemaligen Finanzdirektors Richard Grasl – inzwischen Chefproducer des ORF und Geschäftsführer von ORF On –, gilt als der Kandidat der neuen ÖVP. Aber man irre sich nicht in ihm. Roland Weißmann möchte als Journalist verstanden und wahrgenommen werden. Seine Pläne für die digitale Zukunft des ORF versprechen Meinungspluralität und einen „Boost“ für Formate, die wir sonst nur aus Deutschland vom öffentlich rechtlichen Onlineangebot Funk.net kennen.
• Lisa Totzauer: Die sich selbst als schwarze Alternative zu anderen Kandidatinnen präsentierende Channel Managerin von ORF1 wurde ebenfalls im St.Pöltner Landesstudio geprägt. Trotz starken hausinternen Widerstands ist ihr in den vergangenen Monaten viel mehr gelungen, als man in der Öffentlichkeit wahrnimmt. „Fakt oder Fake“, „Fannys Friday“, Schulfernsehen während der Lockdowns, eine Ausweitung der Sendeplätze von Dokeins. Es scheint, als wäre Totzauer schon länger im Wahlkampf, wenn sie sich bemüht, stimmberechtigten Stiftungsräten zu gefallen: indem sie Peter Kliens „Gute Nacht Österreich“ oder das investigative Unterhaltungsprogramm „A Team für Österreich“ einfach absetzt.
• Kathi Zechner: In jedem anderen Land dieser Erde wäre es wohl selbstverständlich, dass sich eine Frau mit dieser Erfahrung und solcher Leidenschaft fürs Programm um die Generaldirektion bewirbt. Zechners prägende Jahre waren jene im Team von Gerhard Zeiler. Bis heute profitiert der ORF von den zahlreichen Innovationen, die damals für das Publikum und nicht für etwaige Gremienmitglieder entwickelt wurden. Zechner liebt „Leuchtturm-Projekte“ – von „Maximilian“ bis Conchita Wurst. In Zeiten von „Binge Watching“ gilt es darüber hinaus aber die Alltagsprogramme zu pflegen.
• Georg Spatt zeigt als Ö3-Chef, wie öffentlichrechtliches Selbstverständnis in digitalen Zeiten aussehen sollte. Er führt den Tanker Ö3 wohl nicht zuletzt deshalb so erfolgreich, weil dieser quasi autonom vom ORF-Zentrum in Heiligenstadt arbeiten konnte. Nun muss aber aufgrund der zentralistischen Baupläne der aktuellen Geschäftsführung nicht nur Ö1 das legendäre Funkhaus in der Argentinierstraße verlassen, sondern auch Ö3 ins ORF-Zentrum übersiedeln. Hoffentlich bleiben die Kreativität und das Engagement der Radioredaktionen auch auf dem Küniglberg erhalten, wo die warum auch immer angsterfüllte und bedrückende Arbeitsatmosphäre viel zu viele Mitarbeiter mit den Jahren in deren Kreativität deformiert.
• Waltraud Langer: Sie verantwortet die vielleicht heikelsten Formate, die man im ORF-Fernsehen zu gestalten hat: „Report“, „Weltjournal“, „Eco“, „Thema“, „Am Schauplatz“. All diese Programme sind ausgewogen, journalistisch anspruchsvoll, sensibel kuratiert. Die Journalistin Langer lebt das „Audiatur et altera pars“. Sie agiert unaufgeregt und kompetent. Inszeniert sich nie. Und was eine starke Führungspersönlichkeit einfach auszeichnet: Waltraud Langer umgibt sich mit Sendungsverantwortlichen, die ausgesprochen starke Persönlichkeiten sind. Keine Jasager, keine Erfüllungsgehilfen, sondern Menschen, die manches vielleicht sogar besser können als sie.
• Werner Herics spricht nicht nur kroatisch, er leitet auch die Herstellung der Programme für die Volksgruppen. Neben dieser zutiefst öffentlichrechtlichen Tätigkeit kann Herics aber auch auf eine Zeit zurückblicken, als er für Privatmedien tätig war. Darüber hinaus hat er keine Scheu, sich als Landesdirektor mit einem Landeshauptmann, wie jenem im Burgenland, auch einmal anzulegen. Eine Art Antithese zu dem, wofür das Studio Niederösterreich steht.
Kandidaten außerhalb des ORF
Immer wieder werden auch Quereinsteiger aus der Welt der Medien für die ORF-Führung genannt. So könnten die Präsentationen für die Zukunft des ORF von folgenden zwei Journalisten spannend sein:
• Sebastian Loudon: Er war erstgereiht für die Geschäftsführung der RTR. Lediglich die Personalpolitik des damaligen Ministers, Thomas Drozda, hat seine Bestellung verhindert. Das journalistische Know-how und die Kompetenz in Medienfragen kennt man von Loudon und kann man auch im Nischenmedium „Datum“ Monat für Monat bestätigt finden.
• Walter Hämmerle: Die „Wiener Zeitung“ hat deshalb eine wirklich realistische Chance auf Zukunft (auch nach Einstellung des gedruckten Amtsblattes), weil Walter Hämmerle die älteste noch erscheinende Tageszeitung der Welt aus allen parteitaktischen Geplänkeln heraushalten konnte und mit unheimlicher Konsequenz auf die Pflege von Inhalt und journalistischer Substanz Wert legt. Er weiß, wie man ein Medium, das sich im Besitz der öffentlichen Hand befindet, zu einem echten Qualitätsmedium macht. Auch dem ORF täte bekanntlich eine Qualitätsoffensive gut.
• Martin Radjaby-Rasset steht für die Gegenwelt der „Wiener Zeitung“. Er kommt aus der Werbung und dem Marketing. Die Qualität seiner Kampagnen beeindruckt und verblüfft. Die Grünen möchten ihn wohl an der Spitze des ORF sehen.
Um schließlich die verschiedenen Blickwinkel auf die Zukunft eines öffentlich-rechtlichen Mediums abzurunden, wäre auch die Präsentation von Privat-TV-„Übervater“ Markus Breitenecker interessant. Nachdem die Eigentümermehrheit des börsenotierten Konzerns seiner Sendergruppe nun wohl bald in die Hände der Familie Berlusconi fällt, hat ja vielleicht auch er Interesse an einem Jobwechsel?
Und wenn irgend möglich, bitte außerdem noch Hearings mit Stefan Ströbitzer, Matthias Settele, Anja Reschke, Christine Strobl, Barbara Hans, Andreas Bönte und Susanne Wille. Damit sich das ORF-Publikum ein Bild von den Plänen der Kandidatinnen und Kandidaten machen kann, sollten alle Hearings gestreamt oder auch auf ORF III live übertragen werden. Mit einer Übertragung der Hearings könnten sich Zuseherinnen und Zuseher selbst davon überzeugen, ob nach Qualität oder aus parteipolitischen Gründen abgestimmt wird. Bekanntlich sitzen zwar keine Politikerinnen und Politiker im Gremium, aber nichtsdestotrotz geben die den Parteien nahestehenden Freundeskreise vor, wer wen zu wählen hat.
ZUM AUTOR
Golli Marboe (*1965) war viele Jahre lang TVProduzent. Heute ist er unter anderem Obmann des Vereins VsUM (Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien) und sitzt für NEOS Lab im ORF-Publikumsrat.