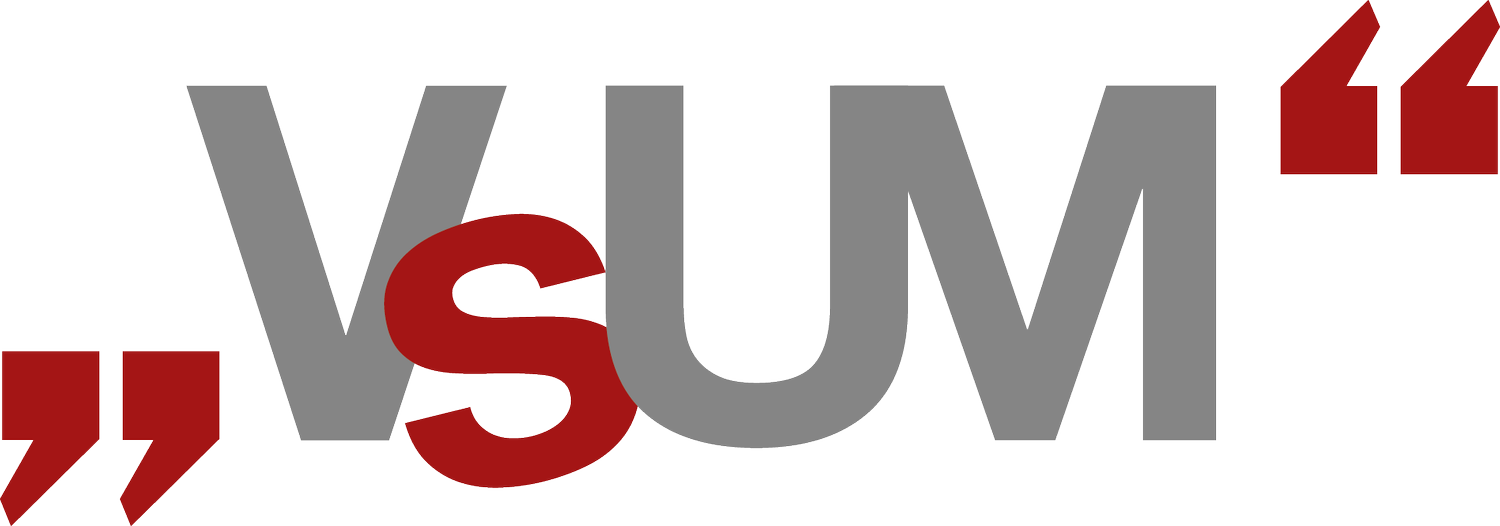Suizidale Krisen: "Redet darüber"
Suizidale Krisen: "Redet darüber"
Hinschauen und ansprechen - aber richtig: Das Thema Suizid zu meiden aus Angst, Nachahmer zu generieren, kann das Gegenteil bewirken.
Artikel zum VsUM Symposium “Papageno-Effekt” von Petra Tempfer , Erstveröffentlichung: Wiener Zeitung am 15. Oktober 2020
Petra Tempfer Redakteurin | Österreich
Bei Papageno, der eigentlich spaßigen Figur aus Mozarts Oper "Die Zauberflöte", sind es drei Knaben, die ihn vom Suizid abhalten. Weil er glaubt, dass er seine geliebte Papagena für immer verloren hat, will er Suizid begehen. Auf den Rat der drei Knaben hin spielt er jedoch in letzter Hoffnung sein Glockenspiel - und Papagena erscheint.
Diese Szene gab dem Papageno-Effekt seinen Namen: Die richtige Berichterstattung über Suizide und das Ansprechen des Themas kann demnach Suizidgedanken verringern. Seit 2017 ist der Papageno-Effekt zum Beispiel auch Teil der Medienempfehlungen der WHO. Eine gewisse Enttabuisierung des Themas sei zwar bemerkbar -noch immer werde es aber großteils gemieden, hieß es am Mittwochabend beim Symposium "Der Papageno-Effekt" des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien in Wien.
"Geht nicht um Ratschläge"
Warum? Aus Angst vor dem Werther-Effekt, dessen Name wiederum auf "Die Leiden des jungen Werthers" von Johann Wolfgang Goethe basiert: Im Zuge des Briefromans erlebt der Leser den Suizid des unglücklich verliebten Rechtspraktikanten Werther mit. Die vorerst anonyme Erstveröffentlichung 1774 hatte zahlreiche Suizide Jugendlicher zur Folge.
Berichte und das Reden über Suizide generierten aber nicht zwingend Nachahmer, sagte Gerald Tomandl vom Kriseninterventionszentrum Wien im Rahmen des Symposiums. Ganz im Gegenteil. "Etwa 30 Prozent all jener, die ins Kriseninterventionszentrum kommen, haben Suizidgedanken. Es kommt aber nicht zum Suizid -weil hingeschaut und das Thema angesprochen wurde. Redet darüber", so Tomandl. Dabei gehe es weniger um bestimmte Schlüsselworte oder Ratschläge, die das Gegenüber vom Suizidgedanken abbringen, sondern darum, aufeinander zuzugehen und einander zuzuhören.
Wird in den Medien darüber berichtet, dann sei jedoch sehr wohl die Wortwahl wesentlich, ergänzte Alexander Warzilek vom Österreichischen Presserat. Einzelne Suizide zu beschreiben und zu verherrlichen sei der falsche Zugang - das Thema an sich anzusprechen, sei hingegen gut und wichtig. Denn nicht nur Verzweiflung, sondern auch Hoffnung könne auf andere übertragen werden.
1.200 Suizide pro Jahr
Psychoanalytikerin Rotraud A. Perner fasste die Thematik noch weiter: Es gehe um den offenen Umgang mit Leben und Tod, den man bereits Kindern vermitteln müsse. "Die ersten sechs Lebensjahre sind prägend", so Perner.
Und dennoch können Eltern, Angehörige oder Freunde trotz aller Bemühungen und Präventionsmaßnahmen einen Suizid nicht immer verhindern. Freya von Stülpnagels Sohn war 18, als er vor 22 Jahren Suizid beging. Noch immer habe er seinen fixen Platz in der Familie. "Es ist nicht so, dass man die Trauer irgendwann verarbeitet", so von Stülpnagel. Heute sei sie nicht mehr lebenshemmend, aber lebensbegleitend. Geholfen habe auch ihr als Hinterbliebene das offene Reden über den Suizid ihres Sohnes - vor allem mit anderen Hinterbliebenen.
Den Suizidberichten zufolge nimmt die Suizidrate in Österreich ab. Waren es 1986 noch 2.300 Fälle pro Jahr, so waren es 2018 rund 1.200. Noch immer sind das aber fast dreimal so viele Tote wie im Straßenverkehr.
Information
Telefonseelsorge: 142
Rat auf Draht: 147
Krisenintervention: 01/4069595
www.suizid-praevention.gv.at