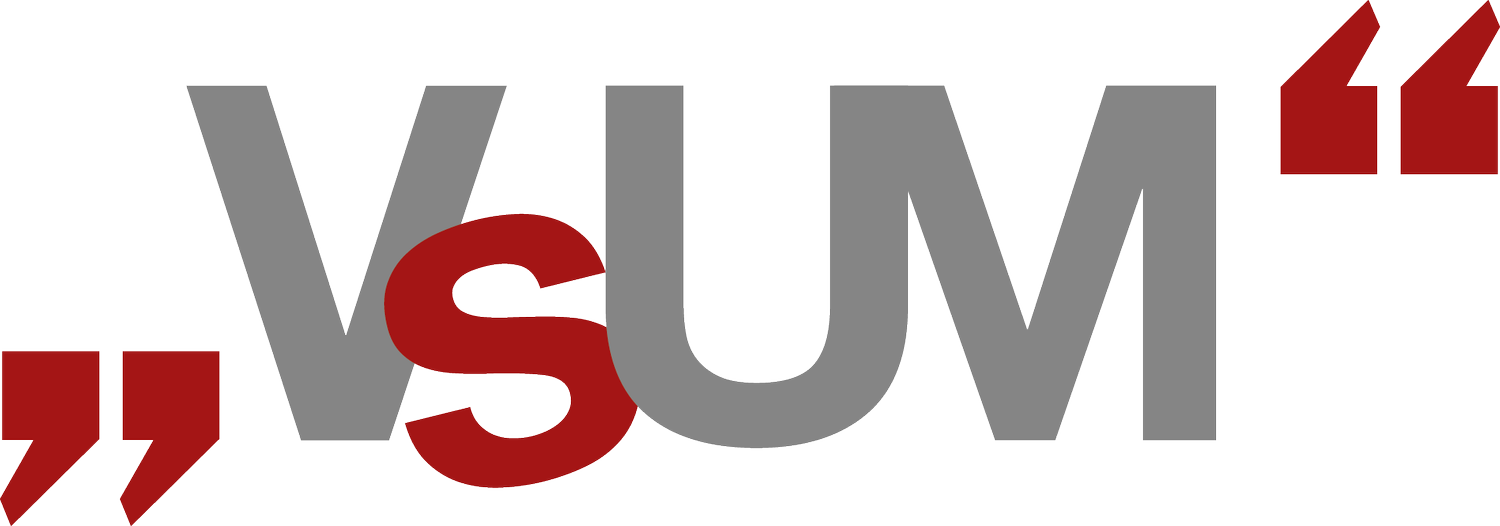Menschen, die sich das Leben nehmen, wollen nicht tot sein
Der Autor Golli Marboe verlor seinen Sohn durch Suizid und macht sich seither für die Themen mentale Gesundheit und für Suizidprävention stark
Es klingelte an der Tür. Jemand sagte: „Da ist etwas mit dem Tobias“. In diesem Moment ist für Golli Marboe eine Welt zusammengebrochen. Tobias, der älteste Sohn der Familie, hat sich das Leben genommen. Fünfeinhalb Jahre sind seit dem einschneidenden Erlebnis vergangen. Fünfeinhalb Jahre, in denen sich der Autor und Journalist aus Wien intensiv mit mentaler Gesundheit beschäftigt hat. Er setzt sich dafür ein, die Sichtbarkeit des Themas in der Gesellschaft zu erhöhen und macht sich für Suizidprävention stark. Über sein Erlebtes hat Marboe ein Buch geschrieben: „Notizen an Tobias – Gedanken eines Vaters zum Suizid seines Sohnes“.
Im Interview spricht Marboe über seine Erfahrungen, sein Engagement und die Arbeit von FRANS, dem Frankfurter Netzwerk für Suizidprävention, das dieses Jahr zehn Jahre alt wird und im September anlässlich des Welttags der Suizidprävention zu einer Autorenlesung aus „Notizen an Tobias“ einlädt.
Inwiefern hat sich Ihr Umgang mit den Themen psychische Erkrankungen und psychischer Gesundheit seit dem Tod Ihres Sohnes Tobias verändert?
Wenn der Sohn sich das Leben nimmt, stellt man sich hunderte Fragen: Haben wir etwas übersehen? Haben wir eine Mitverantwortung? Sind wir schuld? Auf keine dieser Fragen kann man eine Antwort finden. Was wir aber feststellten: Wir als Familie und auch Tobias‘ Freundeskreis wussten sehr wenig über psychische Gesundheit. Wir wussten nicht, wie wir mit jemandem umgehen, der trübsinnig ist und sich in seine Wohnung zurückzieht. Die meisten kennen die Rettungsketten bei körperlichen Beschwerden: Der Sohn verletzt sich beim Skifahren, man bringt ihn ins Krankenhaus. Aber wie handelt man, wenn es dem Sohn psychisch nicht gut geht? Nach Tobias Tod habe ich begonnen, mich intensiv mit dem Thema mentale Gesundheit zu beschäftigen.
Sie sind Mitglied in der Koordinierungsstelle des österreichischen Gesundheitsministeriums für Suizidprävention und Initiator der „mental health days“ für Schülerinnen, Lehrlinge, Pädagoginnen und Erziehungsberechtigte. Was sind Ihre Ziele?
Eines meiner Ziele ist, die Sichtbarkeit des Themas psychische Gesundheit in der Gesellschaft zu erhöhen, klarzumachen, dass man über Gefühle sprechen kann, darf und soll. Wir alle sollten uns fragen, wie wir als Gesellschaft daran arbeiten können, dass weniger Menschen psychisch krank werden. Hier ist Prävention das Thema der Stunde. Durch Tobias Tod wurde ich zu einem Erfahrungsexperten. Das ist eine Expertise, die ich mir niemals gewünscht habe, die ich jetzt aber dafür einsetzen möchte, einen Diskurs und Veränderungen in der Gesellschaft anzustoßen.
Wie sollte Prävention aus Ihrer Sicht aussehen?
Ich wünsche mir, dass alle die Möglichkeit haben, regelmäßig Gespräche mit Psychotherapeutinnen und -therapeuten zu führen. Nicht erst, wenn schon eine Auffälligkeit besteht, sondern vorsorglich und ohne Anlass. So, wie man regelmäßig zur Kontrolle zum Zahnarzt gehen kann, der dann vielleicht ein kleines Loch entdeckt und es füllen kann, bevor eine Wurzelbehandlung nötig ist.
Was hat Sie veranlasst, ein Buch über Ihr Erlebtes zu verfassen?
Es war ein schleichender Prozess. Wenige Tage nach Tobias‘ Tod habe ich damit begonnen, ihm zu schreiben und so eine Kommunikation mit ihm aufzubauen. Im Laufe der Zeit erfuhr ich, dass viele Menschen in einer ähnlichen Situation sind oder waren wie meine Familie und ich. Beinahe täglich kamen und kommen Menschen auf mich zu und berichten von dem, was sie erlebt haben. Am Ende der Gespräche fällt fast immer der Satz: „Bitte erzähle es niemandem“. Mich irritiert das: Wer einen Menschen verloren hat, hat kaum noch Kraft. Und dann wendet man seine Kraft auch noch dafür auf, nicht über das Erlebte zu sprechen. Über diese Erfahrungen habe ich in Artikeln, Beiträgen und Kommentaren geschrieben. Und schließlich entstand daraus die Idee zu „Notizen an Tobias“.
Haben Sie sich bereits vor dem Tod Ihres Sohnes mit dem Thema Suizid befasst?
Als Journalist habe ich viele Kontakte im Wiener Künstlermilieu. Dort wird Suizid thematisiert, allerdings in einer eigenartig verklärten Form, in der Suizid mit freiem Willen verbunden wird. Inzwischen weiß ich: Ein Suizid geschieht in der Regel nicht aus freiem Willen. Oftmals führen psychische Erkrankung zum Suizid. Diese Erkrankungen erlauben den Betroffenen in akuten Krankheitsphasen nicht, sich frei zu entscheiden. Menschen, die sich das Leben nehmen, wollen nicht tot sein. Sie wollen so, wie sie leben, mit ihren Schmerzen und Ängsten, nicht weiterleben.
Warum ist es wichtig, offen über Suizid zu sprechen und in den Medien darüber zu berichten?
Wenn achtsam und sensibel über Suizid berichtet wird, können Selbsttötungen verhindert werden. Es ist wichtig, Menschen mit Suizidgedanken zu verdeutlichen, dass sie nicht allein sind, dass auch viele andere in einer Krise stecken und es Hoffnung gibt. Eine solche Berichterstattung kann Wissen vermitteln und Suizidgedanken verringern. Man spricht dann vom Papageno-Effekt, einer positiven Nachahmung. Manchmal denken Menschen, die sich das Leben nehmen wollen, ihren Angehörigen und Freunden würde es bessergehen, wenn sie selbst nicht mehr leben würden. Weil sie ihnen dann vermeintlich nicht mehr zur Last fallen. Mit einer achtsamen Berichterstattung können Medien darstellen, dass es Angehörigen und Freunden absolut nicht bessergehen wird, sondern viel schlechter, wenn sie einen Menschen durch Suizid verlieren.
FRANS feiert dieses Jahr seinen zehnten Geburtstag – wie bewerten Sie die Arbeit des Netzwerks?
Eine seriöse Initiative wie FRANS, die den Dialog über psychische Gesundheit und Suizid anheizt und damit an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen appelliert, ist ein Riesengewinn für unsere Gesellschaft. Sie ist gleichzeitig eine notwenige Arbeit für die Zukunft, die nachfolgenden Generationen hilft, verantwortungsvoll durchs Leben zu gehen.
Interview: Anja Prechel